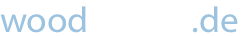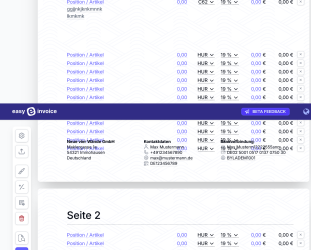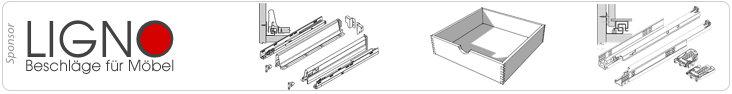Als ich heute früh #109 gelesen hatte, zauberte mir die Tatsache, dass die Skonto-Geschichte wohl vom Normungsgremium schlicht vergessen wurde, wieder ein Grinsen ins Gesicht. Vor allem, weil ich vor längerer Zeit schon einmal den (deutschen?) Ansatz aufgeschnappt hatte, in "Payment terms" - eigentlich der "Prosateil" einer eRechnung - dafür eine zusätzliche Struktur zu etablieren. Komischer Ansatz meiner bescheidenen Meinung nach.
Ich frage mich - auch bei anderen Normierungen in völlig anderen Bereichen - ob es nicht sinnvoll wäre, im Normungsprozess ein bisschen Geld dafür auszugeben, dass man ein paar ausgewählte tasächlich wirtschaftlich agierende Anwender dafür bezahlt, dass sie solche Dinge schon in einer frühen Phase auf Praxistauglichkeit parallel zu ihren etablierten Prozessen testen.
Also, der "Skontofall", bin ich mir sicher, wäre wohl schnell aufgefallen.
Girocodes in einer Rechnung abzubilden ist meiner Meinung nach ja eher im B2C-Umfeld nützlich. Der QR-Code besteht ja nur aus rund einem Dutzend Zeilen und symbolisiert nichts anderes, als die Daten einer anzulegenden Sepa-Überweisung.
Im B2B-Umfeld werden wohl die wenigsten den scannen... zumal die eRechnung ja gerade auch dazu führen soll, solche Prozesse voll digital zu gestalten.
Zumindest momentan ist ist der DSGVO-Hinweis natürlich in den meisten Fällen obsolet, weil im B2B-Bereich meist keine personengebundenen Daten natürlicher Personen verarbeitet werden. Aber selbst da - so scheint die Rechtssprechung momentan zu sein - kann man schon mit einem Rechnungsempfänger a la "XYZ GmbH, Zentraleinkauf - z.Hd. Herrn Max Mustermann" dann doch wieder in deren Geltungsbereich sein.
Ich verstehe aber die Hinweise darauf nicht. Es schreibt doch niemand mehr Rechnungen handschriftlich. Und niemand löscht unmittelbar nach der Rechnungsstellung die Kundendaten, egal ob eine klassische oder eine E-Rechnung gestellt wird. Damit sind m.E. die Datenschutzanforderungen nach wie vor die selben.
Es ging darum, dass die DSGVO nicht nur die Verantwortlichkeiten der unmittelbar Beteiligten, also Auftraggeber und Auftragnehmer, festlegt, sondern auch dafür sorgt, dass auch der komplette "Rattenschwanz" zusätzlicher Beteiligter Berücksichtigung findet. Sprich: Wenn der Auftragnehmer sich an irgendeiner Stelle des Prozesses eines Dienstleisters bedient, muss er in der Regel mit diesem einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abschliessen.... und diesen auch gegenüber dem Auftraggeber benennen. In dem Fall wäre Jan mit seiner Webapplikation der Auftragsverarbeiter... der allerdings seine Nutzer mangels Registrierungspflicht gar nicht kennen würde. Und der Auftragnehmer, der die Dienstleistung in Anspruch nimmt, hätte im Fall der Fälle keinen Vertrag über die Auftragsverarbeitung vorzuweisen.
Ích hab' ja aber auch nicht insistiert, dass das ein Showblocker sein muss, sondern habe lediglich darauf hingewiesen, dass man das zumindest einmal juristisch abklopfen lassen sollte. Das hat Jan ja aufgenommen. Insofern muss das imho ja auch nicht weiter debattiert werden.
Funfact am Rande... Solche Auftragsverarbeitung-Vertragskonstrukte kenne ich sogar für hundertprozentige Tochterfirmen der Gesellschaft... und finde spätestens das ein bisschen übertrieben. Die Juristen sahen es aber anders.