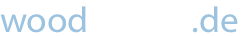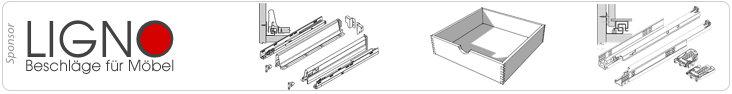Moin,
klar wurde in der Vergangenheit große Fehler in der Waldwirtschaft gemacht.
Z.B. die Biergläser nicht richtig voll schenken

(Kleiner Scherz am Rande!)
Aber was sollte geschehen nach dem die Alliierten den Harz kahlgeschlagen hatten?
Genau so wie viele Generationen vorher den ursprünglichen Baumbestand weitgehend
vernichtet hatten.
Vor 5000 Jahren war Germanien fast komplett mit Mischwälder aus Eichen, Linden und Eschen bestanden. Vor 2500 Jahren wurde das Klima kühler und feuchter. Das führte zu einer Veränderung Richtung zunehmendem Bestand an von Buchen dominierten Mischwäldern.
Der Niedergang dieses natürlichen Waldes begann vor ca. 600 Jahren.
Für den gestiegenen Holzbedarf für Schiffe, den Bergbau, von Holzkohle für die Metallgewinnung, Asche für die Glasherstellung, Eichenrinde zum Ledergerben, und die Salzsiederei bei gleichzeitigem starkem Bevölkerungswachstum wurde abgeholzt, was irgend ging.
Exemplarisches Beispiel: Die Lüneburger Heide.
Größer werdenden Ackerbaugebieten hatte Wald zu weichen.
Erst als die Jagt der Fürsten immer schwieriger wurde und Bauholz immer knapper,
wurde zunehmend erkannt, dass Wälder bewusst bewirtschaftet werden müssen.
Vom natürlichen Wald ist seit damals trotzdem nicht viel übrig geblieben.
Um 1715 erschien das Buch "Sylvicultura Oeconomica" von Hans Carl von Carlowitz mit
einem Aufruf zur beständigen Nutzung des Waldes mit der Forderung,
dass für jeden Baum, der gefällt wird, ein neuer zu pflanzen sei.
Seinen Forderungen lag allerdings rein ökonomisches Denken zugrunde,
an Ökologie war damals nicht zu denken.
Jedoch ging das Kahlschlagen weiter bis es bis in die 1800-er Jahre hinein seinen Höhepunkt erreichte.
Also was tun? Schnell wachsende Baumarten mit guten statischen Eigenschaften anbauen.
Möbelholz war weniger vordringlich als Material für das Bauwesen, den Bergbau, Papier, die Chemische Industrie und andere industriellen Anwendungen.
Klimatisch kamen die Nadelhölzer bis zur letzten Jahrhundertwende gut klar,
nur jetzt wird ein Stück Fehlplanung deutlich.
Trockenere und heißere Sommer, weniger kalte Winter bringen
besonders die Fichte an bis über die Grenze ihrer Toleranz
gegenüber ihren falschen Standorten,
die Forstwirtschaft wird nun gescholten, aber soll gefälligst Gelder abführen und gleichzeitig Zukunftsleistungen erbringen, die sich erst in Jahrzehnten positiv auswirken können.
Aus dieser Zwangslage heraus kann ich verstehen,
dass Teilflächen, entgegen des Wünschenswerten, weiterhin mit Monokulturen wie
Pappel, Birken und sogar Fichten bestanden werden.