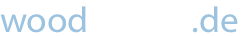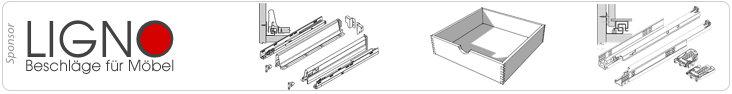Grobmotoriker
ww-kastanie
Hallo,
sollte die Frage etwas OT sein - sorry. Fühle mich aber durch einige ähnlich gelagerte Fragen zum Werkstattbau hier in letzter Zeit etwas ermutigt
Also: Über diesen Sommer konnte ich mir einen lang gehegten Traum erfüllen und auf unserem Grundstück ein Holzhäuschen als Werkstatt bauen. Dabei handelt es sich um ein zimmermannsmäßig errichtetes Ständerwerk, mit Lärche in überlugter Schalung verkleidet. Das unten angehängte Bild gibt eine Vorstellung.
Über den Winter möchte ich jetzt allmählich an eine Innendämmung gehen, perspektivisch soll ein kleiner Werkstattofen dafür sorgen, dass man auch in der kälteren Jahreszeit drin arbeiten kann, ohne dass die Finger am Werkzeug festfrieren.
Im Idealfall möchte ich nur das Ständerwerk so ausdämmen, dass das Fachwerk selbst sichtbar bleibt - möglichst also keine komplette Innenverkleidung mit OSB, Seekiefer oder dgl.
Irgendwie erfreut mich der Anblick des traditionell verzapften Ständerwerks - wär schade, es unsichtbar zu machen
Im Moment wälze ich folgende Varianten:
- Fachwerk nur mit Holzfaser- oder Hanfplatten ausdämmen, keine Dampfbremse, keine Innenverkleidung.
- Fachwerk wie eben genannt ausdämmen, dann die Fächer zusätzlich mit OSB verkleiden (Tragleisten an Balken, Balken selbst bleiben sichtbar), dabei würde OSB gleichzeitig als Dampfbremse fungieren.
Hanf bzw Holzfaser scheint wegen des toleranteren Feuchteverhaltens geeigneter zu sein als Glas- bzw. Mineralwolle.
Offensichtlich möchte ich vermeiden, eine regelrechte Dampfbremse zB mit diffusionsoffener Folie einzuziehen: Wenn ich die Fächer einzeln mit Folie bearbeite, explodiert der Aufwand - und wirklich dicht wird es eh nicht bei der Unzahl an Anschlussfugen.
Allen Regeln der Kunst folgend, müsste ich natürlich die komplette Bude von Innen mit lückenloser Dampfbremse versehen - aber: Da das absolute Zeitvolumen, dass ich als menschlicher Feuchtespender im Häuschen verbringen werde, ist (leider) ziemlich überschaubar, anderen Feuchteeintrag z.B. über Propangasheizung wird es nicht geben. Duschen werd ich drin auch nicht
Die Boden-Deckel-Schalung ist naturgemäß nicht hermetisch dicht, so dass ein leichter Luftaustausch stets stattfindet, und Hanf bzw Holzfaser puffert evtl. auftretende Luftfeuchte besser als Glaswolle. Ich wiege mich nun in der Hoffnung, dass ich aus diesen Gründen auf eine echte Dampfbremse verzichten kann, ggf. sogar auf die Quasi-Dampfbremse der OSB-Platten, so dass vielleicht das bloße Ausdämmen der Gefache mit den Dämmstoffplatten genügen sollte.
Jetzt die Frage an Forenmitglieder mit entsprechender Fachkompetenz: Wäre das so durchführbar, wie ich es mir vorstelle, oder gehe ich längerfristig ein echtes Risiko für die Holzkonstruktion ein?
Danke vorab für Euren Rat, Uwe

sollte die Frage etwas OT sein - sorry. Fühle mich aber durch einige ähnlich gelagerte Fragen zum Werkstattbau hier in letzter Zeit etwas ermutigt
Also: Über diesen Sommer konnte ich mir einen lang gehegten Traum erfüllen und auf unserem Grundstück ein Holzhäuschen als Werkstatt bauen. Dabei handelt es sich um ein zimmermannsmäßig errichtetes Ständerwerk, mit Lärche in überlugter Schalung verkleidet. Das unten angehängte Bild gibt eine Vorstellung.
Über den Winter möchte ich jetzt allmählich an eine Innendämmung gehen, perspektivisch soll ein kleiner Werkstattofen dafür sorgen, dass man auch in der kälteren Jahreszeit drin arbeiten kann, ohne dass die Finger am Werkzeug festfrieren.
Im Idealfall möchte ich nur das Ständerwerk so ausdämmen, dass das Fachwerk selbst sichtbar bleibt - möglichst also keine komplette Innenverkleidung mit OSB, Seekiefer oder dgl.
Irgendwie erfreut mich der Anblick des traditionell verzapften Ständerwerks - wär schade, es unsichtbar zu machen
Im Moment wälze ich folgende Varianten:
- Fachwerk nur mit Holzfaser- oder Hanfplatten ausdämmen, keine Dampfbremse, keine Innenverkleidung.
- Fachwerk wie eben genannt ausdämmen, dann die Fächer zusätzlich mit OSB verkleiden (Tragleisten an Balken, Balken selbst bleiben sichtbar), dabei würde OSB gleichzeitig als Dampfbremse fungieren.
Hanf bzw Holzfaser scheint wegen des toleranteren Feuchteverhaltens geeigneter zu sein als Glas- bzw. Mineralwolle.
Offensichtlich möchte ich vermeiden, eine regelrechte Dampfbremse zB mit diffusionsoffener Folie einzuziehen: Wenn ich die Fächer einzeln mit Folie bearbeite, explodiert der Aufwand - und wirklich dicht wird es eh nicht bei der Unzahl an Anschlussfugen.
Allen Regeln der Kunst folgend, müsste ich natürlich die komplette Bude von Innen mit lückenloser Dampfbremse versehen - aber: Da das absolute Zeitvolumen, dass ich als menschlicher Feuchtespender im Häuschen verbringen werde, ist (leider) ziemlich überschaubar, anderen Feuchteeintrag z.B. über Propangasheizung wird es nicht geben. Duschen werd ich drin auch nicht
Die Boden-Deckel-Schalung ist naturgemäß nicht hermetisch dicht, so dass ein leichter Luftaustausch stets stattfindet, und Hanf bzw Holzfaser puffert evtl. auftretende Luftfeuchte besser als Glaswolle. Ich wiege mich nun in der Hoffnung, dass ich aus diesen Gründen auf eine echte Dampfbremse verzichten kann, ggf. sogar auf die Quasi-Dampfbremse der OSB-Platten, so dass vielleicht das bloße Ausdämmen der Gefache mit den Dämmstoffplatten genügen sollte.
Jetzt die Frage an Forenmitglieder mit entsprechender Fachkompetenz: Wäre das so durchführbar, wie ich es mir vorstelle, oder gehe ich längerfristig ein echtes Risiko für die Holzkonstruktion ein?
Danke vorab für Euren Rat, Uwe